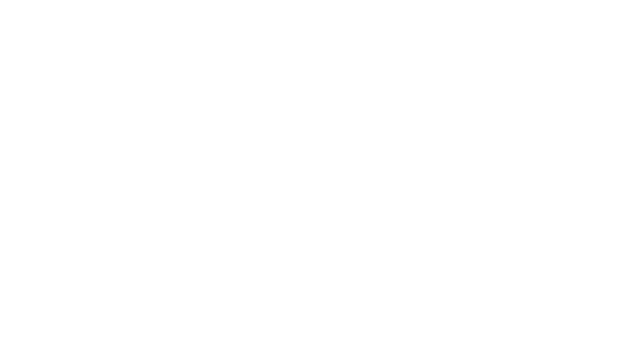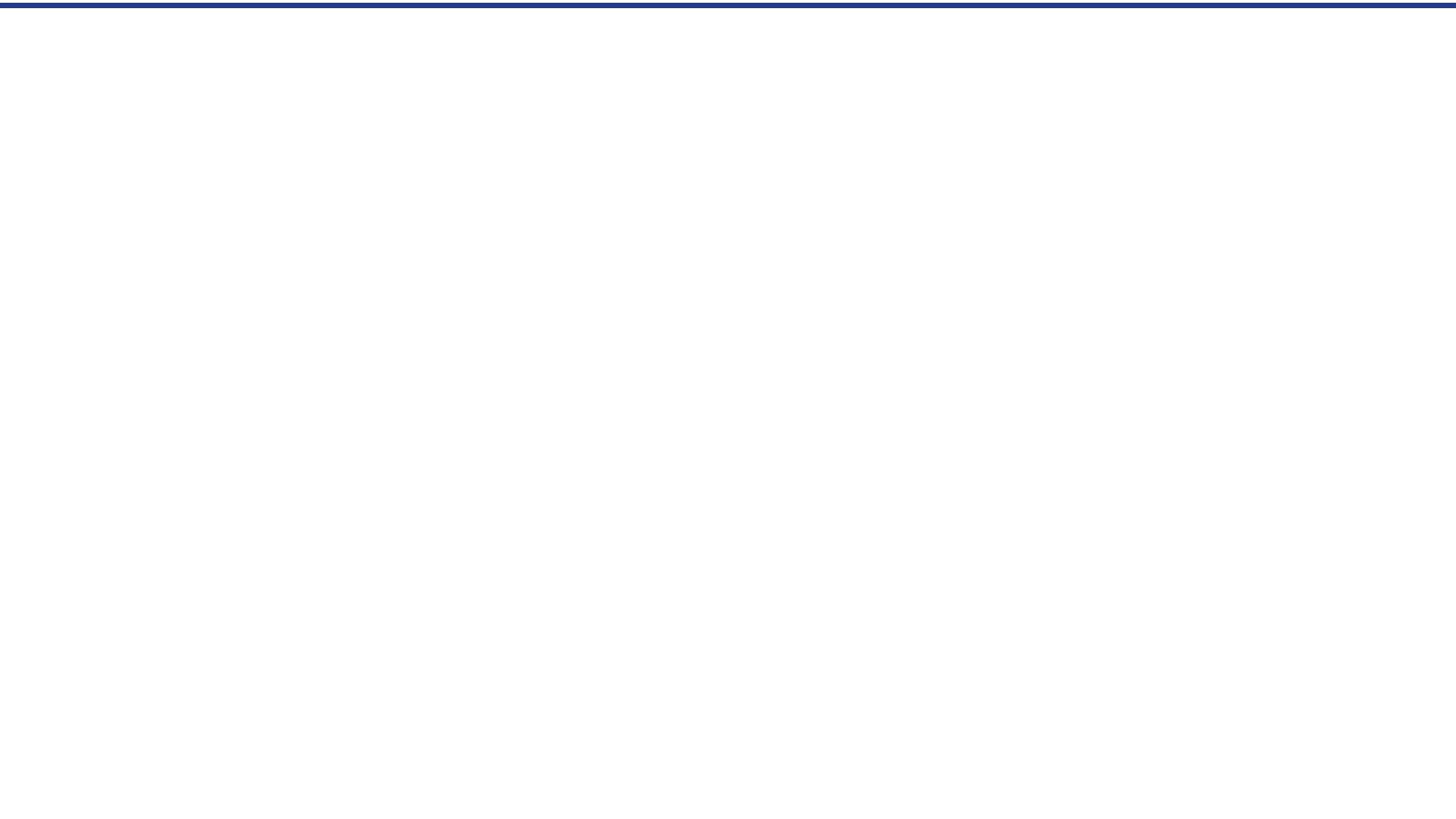Im einleitenden Kapitel schaffen wir den theoretischen Unterbau für die nachfolgenden Inhalte. Sie lernen verschiedene wissenschaftliche Erklärungsansätze für Emotionen kennen, so zum Beispiel:
- den materialistischen Ansatz
- den konstruktivistischen Ansatz
- die kognitive Emotionstheorie
Zudem werfen wir einen Blick zurück in die Geschichte und beleuchten, wie sich der Emotionsbegriff im Lauf der letzten 150 Jahre verändert hat.
Wenn wir unsere eigenen Emotionen analysieren, stellen wir zudem fest, dass Emotionen mehrere Komponenten umfassen:
- die affektive Komponente (subjektives Empfinden)
- die kognitive Komponente (Gedanken über die Emotion)
- die physiologische Komponente (wie unser Körper auf die Emotion reagiert)
- die expressive Komponente (wie wir einer Emotion z. B. mit Mimik und Gestik Ausdruck verleihen)
- die motivationale Komponente (mit der Motivation verbundenes Verhalten)
Sicher haben Sie auch selbst schon erfahren, dass Emotionen positive und negative Effekte haben können – Erfolgserlebnisse motivieren uns, während uns Versagensängste hemmen können, beispielsweise, wenn wir einen Vortrag vor einer größeren Gruppe halten sollen. Gleichzeitig spüren wir, wie sich bei Wut unser Puls beschleunigt und unser Adrenalinspiegel steigt. Sind wir hingegen traurig und niedergeschlagen, wirkt sich das unter Umständen negativ auf unsere Konzentrations- oder Leistungsfähigkeit aus.
Im Folgenden lernen Sie, Emotionen nach dem Circumplex-Modell von Russell einzuteilen und erfahren, wie Emotionen unser Handeln positiv oder negativ beeinflussen können.
Was ist emotionale Intelligenz?
Genauso wie beim Begriff der „Emotion“ gibt es auch für das Konzept der „emotionalen Intelligenz“ verschiedene Definitionen und Erklärungsansätze. In unserem kostenlosen OPEN vhb-Kurs stellen wir Ihnen die wichtigsten Modelle der emotionalen Intelligenz vor:
- Fähigkeitsmodelle, die auf kognitiven Fähigkeiten beruhen
- Eigenschaftsmodelle, die auf Persönlichkeitseigenschaften wie Empathie, Optimismus und Stresstoleranz beruhen
- Mischmodelle, die verschiedene Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften einbeziehen
Einen besonderen Fokus richten wir auf das Vier-Facetten-Modell der emotionalen Intelligenz von Mayer und Salovey, mit dem sich gut veranschaulichen lässt, wie die Komponenten Emotionswissen, Emotionswahrnehmung, Emotionsnutzung und Emotionsregulation bei der emotionalen Intelligenz zusammenspielen.
Weiterhin gehen wir der Frage auf den Grund, wie sich emotionale Intelligenz (EQ) von der allgemeinen Intelligenz (IQ) unterscheidet.